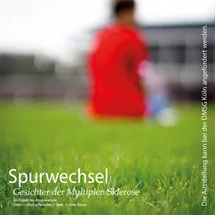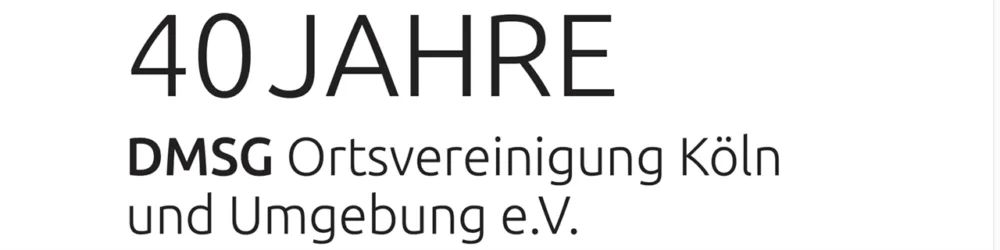
„Das war erbärmlich damals!“
Ein medizinischer Rückblick
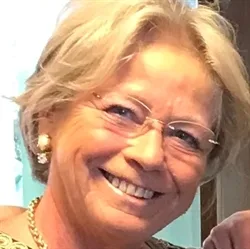
Angelika Haus ist Neurologin in Köln, Gründungsmitglied der DMSG OV Köln und von Anbeginn in der Funktion des Ärztlichen Beirats im Vorstand aktiv.
Dieses Interview wurde im Herbst 2023 anläßlich unseres Jubiläums geführt. Eine Kurzfassung ist in unserer Jubiläums-Broschüre abgedruckt. Sie können die Broschüre über den Link rechts herunterladen.
Welchen Stand hatte die medizinische Entwicklung vor 40 Jahren, als die Kölner Ortsvereinigung der DMSG startete?
Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir in der MS-Behandlung eigentlich nur die Akutbehandlung im Schub durch Cortison-Infusion.
Als einziges Medikament, an das ich mich erinnere, das immunmodulierend wirken sollte, gab es das Azathioprin, das allerdings auch ein paar Nebenwirkungen hatte. Beispielsweise die Gefahr, später mal an Krebs zu erkranken, war nicht so ganz unerheblich. Und es ist auch ein sehr allgemein wirkendes Mittel gewesen. Das war eigentlich das einzige Medikament, was über viele Jahre zur Verfügung stand.
Manchmal haben wir die Cortisontherapie auch eingesetzt als Prophylaxe. Das wurde mehrfach im Jahr gegeben, damit kein Schub auftrat. Aber das war erbärmlich im Vergleich zu dem, was wir heute kennen.
Mit dem Einsatz von Interferonen, da ging es eigentlich los, dass man wirklich in die Zukunft planen konnte, weil die Interferone anfingen, die Schübe zu verringern und die Stärke zu vermindern. Und das war Mitte der 90er Jahre. Damit hat sich die Therapie grundsätzlich deutlich verbessert. Und damit natürlich auch die Verläufe.
Wie war denn die Diagnostik zu dem Zeitpunkt?
In den 80er Jahren gab es zumindest in den Unikliniken schon im Verdachtsfalle die Diagnostik mit Nervenwasser, wie sie bis heute besteht. Mit der Entwicklung des MRT, also des Kernspintomogramms, bekamen wir dann tatsächlich etwas in die Hand, wo man in der bildgebenden Form die entzündlichen Läsionen im Gehirn sehen konnte. Und so konnte man dann mit Kernspin plus Liquor-Untersuchung diagnostizieren, das ist ja auch heute eigentlich noch die gängige Methode.
Wenn Sie dann in die heutige Zeit springen, was halten Sie für die Meilensteine innerhalb der 40 Jahre in Bezug auf die medizinische Entwicklung bei der MS?
Wie gesagt, die ersten Meilensteine waren die Einführung der Interferone und der Einsatz des MRT.
Und dann die Entwicklung der monoklonalen Antikörper (die „-zumabs“, also Alemtuzumab, Natalizumab, später Orcrelizumab) und der S1P-Medikamente, das sind die „-imods“, also Fingolimod und Siponimod, Ozanimod und Ponesimod. Das sind zwei Medikamentenklassen, die ganz viel gebracht haben.
Und was natürlich ganz wichtig war, dass es Medikamente gab, die nicht nur per Spritze, sondern auch oral, also als Tabletten verabreicht werden konnten. Das war für viele Patienten dann doch eine ziemliche Erleichterung. Die Interferone wurden ja früher zum Teil jeden zweiten Tag gespritzt und waren eine erhebliche Belastung, zumal die Interferone auch Nebenwirkungen haben.
Die Nebenwirkungen der neueren Medikamente, der monoklonalen Antikörper zum Beispiel, die gehen gegen Null, wenn man aufpasst in der Verfolgung des Blutbildes, dass also nicht andere Infektionen auftreten, wie zum Beispiel PML bei Natalizumab. Aber das haben wir inzwischen auch ganz gut im Griff.
Was für eine Prognose hatten die Menschen, die vor 40 Jahren diagnostiziert wurden, gegenüber den Menschen, die heute diagnostiziert werden?
Also die optimistischste Prognose damals war, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel: ein Drittel landet im Rollstuhl, ein Drittel ist zumindest körperbehindert, meist schwerer körperbehindert, und nur ein Drittel kommt mit leichten Symptomen davon.
Und das hat sich gewaltig geändert. Wir haben praktisch durch die Medikation, die wir jetzt haben, so gut wie keine oder zumindest sehr selten eine Entwicklung in Richtung Rollstuhl oder gar Bettlägerigkeit. Das hat sich ganz gewaltig verbessert. Es gibt zwar möglicherweise leichtere Gehbehinderungen und Einschränkungen der Motorik und es gibt vor allem die sogenannten weichen Symptome, Fatigue-Syndrome oder kognitive Einschränkungen. Die körperlichen Einschränkungen beschränken sich im Wesentlichen auf entweder leichte Schwächen von Muskelgruppen oder Sensibilitätsstörungen. Aber die Rollstuhlverläufe sehen wir fast gar nicht mehr.
Das heißt, die Menschen, die heutzutage diagnostiziert werden, haben eine deutlich bessere Chance, da gut durchzukommen.
Gibt es auch medizinische Entwicklungen für die Menschen, die schon länger erkrankt sind?
Es gibt Entwicklungen von Medikamenten, die sowohl bei der primär chronischen MS eingesetzt werden dürfen, das ist das Ocrevus, als auch bei der sekundär chronisch progredierenden Form, das ist das Siponimod und das Ponesimod. Die sind aber insofern ein bisschen eingeschränkt im Einsatz, als sie wirklich nur dann wirken, wenn noch eine gewisse Aktivität zu verzeichnen ist. Das heißt, wenn wir entweder doch einen rasanteren Fortschritt der Krankheitssymptome haben oder hin und wieder doch noch mal einen Herd im MRT, dann verspricht man sich auch von diesen Medikamenten auch bei schon länger Erkrankten noch einen gewissen Erfolg. Eine Verbesserung in dem Sinne natürlich nicht, aber eine Stabilisierung, das wäre schon wünschenswert.
Wenn aber ein sehr stummer Verlauf schon sehr lange besteht, dann kann man sich wahrscheinlich auch von diesen Medikamenten nicht mehr viel erwarten.
Dann bleibt höchstens noch die symptomatische Therapie. Im Hilfsmittelbereich und auch in der sozialen Unterstützung ist natürlich in der Zwischenzeit auch einiges passiert, sodass man das Leben mit MS etwas erleichtern kann. Aber die eigentliche Krankheit, wenn sie denn schon so lange besteht – das sind dann leider die Menschen, die zu früh erkrankt sind, bevor die Welle dieser sehr positiven Medikamente einsetzte.
Haben Sie eine eigene Einschätzung oder Erfahrung, wie viel Lebensstiländerungen tatsächlich bewirken können?
Ich halte es für sehr wichtig, dass die betroffene Person positiv zu dem steht, was man an Optimierung des Lebensstils tun kann, also Bewegung, Sport, frische Luft, aber auch Ernährungsumstellung. Wenn das positiv untermauert ist und nicht als Zwang, dann hat das auch von der Psyche her einen förderlichen Einfluss und motiviert Menschen, was zu tun. Und damit kann man sicherlich auch den Verlauf ein bisschen umgestalten und die ganze Lebensqualität verbessern.
Wenn man als Mediziner gefragt wird, welche Ernährung dazu dient, konkret die Krankheit aufzuhalten oder die Symptome zu lindern, dann gibt es nichts, was durch irgendwelche Studien erwiesen ist. Aber da spielen natürlich psychologische Placebo-Effekte eine ganz große Rolle. Das sollte man sich ruhig zunutze machen, weil das eben die Lebensqualität verbessern kann.
An welcher Stelle ist die Behandlung und Betreuung von MS-Kranken noch veränderungswürdig?
Wir haben ja besondere Verträge entwickelt mit der Kassenärztlichen Vereinigung zur Versorgung von MS-Patienten unterschiedlichster Art. Die wurden aber immer wieder aufgehoben, wieder neu angelegt. Dieses Hin und Her ist nicht gerade förderlich, weil Sie ständig mit neuen Papieren und neuen Regeln umzugehen haben.
Außerdem: Diese Verbesserungen, die durch diese Verträge erzielt werden sollen, die setzen sich auch nicht durch. Die meisten Krankenkassenmitarbeiter, die kennen das gar nicht. Deswegen werden die Vorteile in der Betreuung von MS-Patienten, die die Verträge vielleicht erbringen sollen, oder Erleichterungen, zum Beispiel eine Reha zu machen oder besondere Sportarten zu betreiben, nicht genutzt. Das wird grundsätzlich von den Krankenkassen, die das dann zur Bearbeitung kriegen, genauso behandelt, als gäbe es diese ganzen Verträge gar nicht.
Also an der Stelle wäre viel mehr Transparenz, möglicherweise auch Schulung nötig, damit allen bekannt ist, dass es das gibt und wie sich das darstellt. Und natürlich die Vereinfachung der Prozeduren, das wäre ganz wichtig, weil Sie in einer übervollen Praxis, so wie unsere neurologischen Praxen zurzeit aussehen, keine Zeit haben, sich immer wieder auf neue Bedingungen und neue Häkchen und Winkelchen einzustellen, die da bei den Verträgen erforderlich sind.
Besonders schlimm ist es, wenn es mit jeder Krankenkasse was anderes geben würde. Da wäre eine Vereinheitlichung und eine Vereinfachung, eine Entbürokratisierung das Zauberwort – das wäre schon sehr sinnvoll und sehr wichtig.
Was sind denn aktuelle Forschungsprojekte im Bereich MS?
In die Zukunft geblickt gibt es jetzt die Idee, dass man nicht nur an der Immunsituation insgesamt etwas ändert, um der MS zu begegnen, die ja ein Autoimmunprozess ist, sondern dass man auch das, was dieser Prozess bewirkt im Körper, dass man das direkt angeht.
Da geht es um die sogenannten Kaliumkanäle, die sich also verändern durch die Entzündung, und da gibt es Medikamente, die der Veränderung entgegenwirken und somit die Schädigung durch die Entzündung an der Nervenzelle stoppen. Eine sogenannte kausale Therapie. Das ist in der Entwicklung und da gibt es ein Medikament, das ursprünglich gegen Epilepsie entwickelt wurde und bei dem jetzt die Zulassung für die Behandlung der MS empfohlen wird. Die Studien scheinen erfolgreich verlaufen zu sein. Das ist aber bei uns noch nicht auf dem Markt, aber das kommt sicherlich demnächst.
Und natürlich das Thema Remyelinisierung, das ist schon immer ein Thema, nur man hat bisher noch nicht die richtigen Medikamente gefunden, die das tatsächlich bewerkstelligen. Die Remyelinisierung steht ganz im Vordergrund, weil das ja tatsächlich einer Heilung ähnlich käme. Und man hat auch bei manchen Studien festgestellt, dass eine gewisse Remyelinisierung stattfindet, dass die Funktion aber doch nicht so wiederhergestellt werden konnte, als wäre nie was geschädigt gewesen. In die Richtung wird geforscht.
Und dann ist da natürlich auch die Stammzellentherapie, das sind in der Summe natürlich auch Themen, die schon in die Zukunft reichen.
Ich würde noch ganz gerne wissen: Sie waren ja eines der beiden bis heute noch aktiven Gründungsmitglieder. Was war Ihre Motivation, damals mitzumachen?
Also die Motivation war natürlich das Krankheitsbild als solches. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Rehabilitationszentrum der Universität Köln gearbeitet, bei Professor Jochheim. Da wir damals einige MS-Patienten in der Rehabilitation zu betreuen hatten und ich mich darum auch gekümmert habe, hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich an der Gründung der Ortsvereinigung der DMSG zu beteiligen.
Damals stand mein Facharzt an und ich wollte mich auch niederlassen, insofern war ein Schwerpunkt MS für mich eigentlich immer schon im Visier. Und das hat sich dann auch so ergeben, ich habe zufällig einen Praxissitz übernommen eines älteren Kollegen, der seine Praxis aufgeben wollte. Der hatte einen Schwerpunkt Parkinson und Multiple Sklerose und das passte natürlich alles wunderbar.
Ihre Aufgabe im Vorstand war dann die medizinische Beratung?
Ich bin ja der medizinische Beirat – so habe ich meine Aufgabe immer verstanden, dass darauf geachtet wird, dass alles, was die DMSG-Ortsvereinigung unternimmt, unter medizinischen Gesichtspunkten sinnvoll ist und dass man auf der anderen Seite nicht übers Ziel hinausschießt. Damit meine ich zum Beispiel, dass man jetzt ein besonderes Forschungsprojekt anstellt als DMSG in Köln. Bei sowas habe ich dann zum Beispiel gesagt, das bringt nichts. Dazu braucht man derartig umfängliche, multizentrische Studien. Das nützt nichts, wenn da eine Ortsvereinigung anfängt, mit einem Professor rumzuforschen.
Auf der anderen Seite zum Beispiel, dass Veranstaltungen eben krankheitsgerecht sind. Das war früher noch viel wichtiger als jetzt. Früher waren dann Projekte vielleicht geplant, wo man sagte, wer kann denn eigentlich von diesen MS-Patienten daran teilnehmen, weil die Rahmenbedingungen z.B. nicht barrierefrei waren.
Und dann machen wir natürlich – früher im Rahmen der DMSG, inzwischen selbstständig mit Herrn Professor Nelles – diese Weiterbildung, die Vorträge für Patienten und Angehörige viermal im Jahr, um alle immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das finde ich ist eine Leistung auch für die DMSG, um unsere Patienten gut zu informieren. Es ist witzig, die Vereinszeitung informiert wunderbar, aber die Leute lesen sie nicht oder es leuchtet ihnen noch mehr ein, wenn da vorne jemand steht und was erzählt. Wir haben jedenfalls einen guten Zulauf.